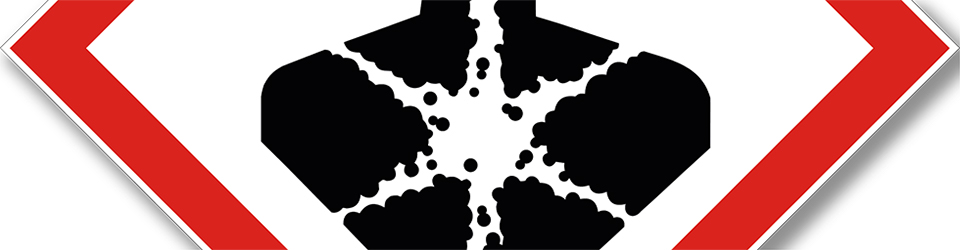Schutz vor arbeitsbedingten Erkrankungen durch Asbest
Arbeitsschutzgesetz und Arbeitssicherheitsgesetz

Bild von Pete Linforth auf Pixabay
Grundlage für den Schutz vor arbeitsbedingten Erkrankungen durch Asbest bildet das Arbeitsschutzgesetz ArbSchG. Der vollständige Titel lautet Gesetz über die Durchführung von Maßnahmen des Arbeitsschutzes zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Beschäftigten bei der Arbeit.
Das Gesetz stammt aus dem Jahr 1996, trat also in dieser Form erstmals 3 Jahre nach dem Asbestverbot in Deutschland in Kraft. Der moderne Arbeitsschutz, wie wir ihn heute kennen wurde allerdings bereits 1973 mit dem Arbeitssicherheitsgesetz ASiG begründet.
Da Asbest bereits damals bekanntlich Krebs verursachen konnte und Arbeitgeber dazu gesetzlich verpflichtet wurden, die Gesundheit ihrer Mitarbeiter*innen vor Erkrankungen durch Gefahrstoffe zu schützen, blieb in der Folge nur noch ein generelles Verbot der Herstellung, Verwendung und des Inverkehrbingens von Asbest und daraus hergestellten Produkten.
Das Asbestverbot enstammt also nicht der Einsicht, dass Asbest alle Menschen krank machen kann, sondern in Folge des modernen Arbeitsschutzes, der allerdings nur Arbeitgeber und Arbeitnehmer berücksichtigt und nicht Privatpersonen.
EU-Richtlinie 2009/148/EG

“…über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz (früher: Richtlinie 83/477/EWG)”.
Die EU-Richtlinie 2009/148/EG bildet die Grundlage für das Asbestverbot in Deutschland und später in der EU. EU-Richtlinien sind zwar verbindliche rechtliche Vorgaben, müssen aber in den Mitgliedsstatten in nationales Recht umgesetzt werden. Und dafür haben die Mitgliedsstaaten etwas Zeit.
Im Titel steht zwar 2009 am Anfang, die ursprüngliche Richtlinie ist jedoch bereits aus dem Jahr 1983. Deutschland hat also danach noch 10 Jahre gebraucht, bis im Rahmen der Gefahrstoffverordnung GefStoffV Asbest 1993 in Deutschland verboten wurde. Seit Änderung dieser Richtlinie im Jahr 2003 besteht für alle europäischen Mitgliedsstaaten die Verpflichtung, Asbest bzw. genauer: “Herstellung und Verwendung von Asbest und Erzeugnissen daraus” zu verbieten. Erst 2005 wurde dieses Verbot europaweit umgesetzt.
Gefahrstoffverordnung GefStoffV
 Die Gefahrstoffverordnung bezieht sich auf die REACH Verordnung und präzisiert das Verbot in Anhang II (zu § 16 Absatz 2) Besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, Nummer 1 – Asbest
Die Gefahrstoffverordnung bezieht sich auf die REACH Verordnung und präzisiert das Verbot in Anhang II (zu § 16 Absatz 2) Besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Gemische und Erzeugnisse, Nummer 1 – Asbest
Die Gefahrstoffverordnung (kurz: GefStoffV) wurde im Dezember 2024 neu gefasst und in einer gründlich überarbeiteten Version neu aufgelegt.
Erstmals wurden große Teile der TRGS 519 (ASI Arbeiten mit Asbest, rechtlich nicht- bzw. quasi-verbindliche Vorschrift, aber keine “echte” Rechtsvorschrift) in die GefStoffV aufgenommen. Darüber hinaus wurden Mitwirkungspflichten für Auftraggeber festgelegt, durch die nun auch Privatpersonen in der Pflicht sind, wenn sie Asbest-Arbeiten in Auftrag geben. Dabei ist wichtig, zu beachten, dass alleine der Verdacht, dass Asbest vorhanden sein könnte, bereits ausreicht. Diese “Veranlasserpflicht” erstreckt sich aber nicht ausschließlich auf Asbest, sondern alle Gefahrstoffe, die sich in älteren Gebäuden verstecken können und durch die bei deren Freisetzung Beschäftigte, also Mitarbeiter von Handwerksbetrieben, einer gesundheitlichen Gefahr ausgesetzt sein könnten.
Veranlasserpflicht
Die Pflicht besteht darin, dem Auftragnehmer im Voraus alle verfügbaren Informationen zum Gebäude, insbesondere das Baujahr, mitzuteilen. Wird dies versäumt, ist dies eine Ordnunsgwidrigkeit und bei einer späteren gesundheitlichen Schädigung eines Beschäftigten ggf. sogar eine Straftat.
§ 5a Besondere Mitwirkungs- und Informationspflichten für Veranlasser von Tätigkeiten an baulichen oder technischen Anlagen
(1) Derjenige, der Tätigkeiten an baulichen oder technischen Anlagen veranlasst (Veranlasser), hat vor Beginn der Tätigkeiten dem ausführenden Unternehmen alle ihm vorliegenden Informationen zur Bau- oder Nutzungsgeschichte über vorhandene oder vermutete Gefahrstoffe schriftlich oder elektronisch zur Verfügung zu stellen. Der Veranlasser hat sich zur Informationsbeschaffung in zumutbarem Aufwand der ihm zugänglichen Unterlagen zu bedienen. Gefahrstoffe im Sinne von Satz 1 sind solche, die durch die Tätigkeiten freigesetzt werden und zu einer besonderen Gesundheitsgefährdung führen können.
(2) Damit festgestellt werden kann, ob Asbest vorliegt, hat der Veranlasser vor Beginn der Tätigkeiten an Objekten mit Baujahr zwischen 1993 und 1996 das Datum des Baubeginns des Objekts oder das Baujahr des Objekts, sofern das genaue Datum des Baubeginns nicht bekannt ist, an das ausführende Unternehmen schriftlich oder elektronisch zu übermitteln. Bei Objekten mit Baujahr vor 1993 oder nach 1996 reicht die Angabe des Baujahrs aus.
(3) Weiterreichende Informations-, Schutz- oder Überwachungspflichten, die sich für den Veranlasser nach anderen Rechtsvorschriften ergeben, bleiben unberührt.
(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für private Haushalte.
Diese Pflicht erscheint zunächst wenig aufwändig und nicht sehr weitreichend. Dies ist aber ein Trugschluss: Auch wenn der Auftragnehmer verpflichtet ist, aufgrund dieser Informationen festzustellen, ob Asbest vorhanden ist und die Arbeiten entsprechend zu planen (vorausgesetzt, er darf diese überhaupt ausführen), hängt von der Informationspflicht durch den Veranlasser in der Konsequenz sehr viel ab.
Rechtlich ist man nur dann auf der sicheren Seite, wenn diese Information schriftlich erfolgt ist! Alle weiteren Pflichten liegen nun im “Spielfeld” des Auftragnehmers. Nun ist er in der Haftung.
Pflicht zur Durchführung einer Gefährdungsbeurteilung
Auftragnehmer müssen aufgrund der vorliegenden Informationen eine Gefährdungsbeurteilung durchführen (§6 GefStoffV). Hat der Veranlasser versäumt, die Bau- und Nutzungsgeschichte des Objektes mitzuteilen, ist man als Auftragnehmer jedoch nicht automatisch entlastet, denn auch die unbewusste oder unbeabsichtigte Freisetzung von Asbestfasern oder der Umgang damit ohne die nötige Sachkunde ist strafbar. Es ist also zu empfehlen, nicht auf die Informationen zu warten und loszulegen, wenn keine kommen, sondern man erwartet von Handwerksbetrieben, dass sie auch mal nachfragen.
Aufgrund der nach Arbeitsschutzgesetz durchzuführenden Gefährdungsbeurteilung (zu der auch eine technische Erkundung gehören kann), werden die Arbeiten geplant und Schutzmaßnahmen festgelegt. Außerdem ergibt sich, ob ein Handwerksbetrieb überhaupt mit Asbest arbeiten darf und welche Sachkunde dafür erforderlich ist.
Erkundung
Erkundung ist die Ermittlung der nötigen Informationen. Und zwar sowohl die dokumentarische, also die Bau- und Nutzungsgeschichte des Objektes als auch die technische Erkundung, nämlich Probennahme und Analytik.
Leider hat die GefStoffV versäumt zu definieren, wer für welche Erkundung zuständig ist, zumindest über die rein baugeschichtliche Information hinaus. Die Pflicht zur technischen Erkundung ist in der GefStoffV nicht bei der Veranlasserpflicht genannt. der Begriff der technischen Erkundung taucht aber im § 6 (Gefährdungsbeurteilung) auf. Man kann also unterstellen, dass diese Pflicht dem Auftragnehmer auferlegt wurde ud nciht dem Veranlasser.
- Veranlasser: Pflicht der Mitteilung der Bau- und Nutzungsgeschichte des Objektes (einschließlich der “zumutbaren” Erkundung (eher “Recherche”)
- Auftragnehmer: Pflicht der technischen Erkundung (Probennahme und Analytik).
Das schließt jedoch nicht aus, dass Privatpersonen zuvor auch die technische Erkundung durchführen (lassen!). Der Auftragnehmer muss nämlich auch dazu in der Lage sein – und für ihn gelten strengere Vorschriften als für Privatpersonen. Ist der Auftragnehmer nicht fachkundig, muss er sich professionelle Hilfe durch Experten für Probennahme und Analytik holen, kann dies aber dem Auftraggeber als besondere Dienstleistung in Rechnung stellen.
Nimmt der Auftraggeber selbst Proben und sendet sie an ein Labor zur Auswertung, ist es möglich, dass aufgrund seiner fehlenden Fachkunde die Ergebniss rechtlich nicht verwertbar sind. Sie werden im Zweifel eventuell nicht anerkannt, weil unterstellt wird, dass Privatpersonen gar icht wissen, wie man Proben nimmt.
Außerdem besteht auch hier die Gefahr der unbeabsichtigten Faserfreisetzung und zumindest einer Selbstgefährdung.
Fachkunde
Wichtig ist auch §6 (11) GefStoffV: Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Hat der Auftragnehmer keine Fachkunde, muss er sich Unterstützung holn (oder einkaufen).
(11) Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich fachkundig beraten zu lassen. Fachkundig können insbesondere die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt sein.
Verbot des Umgangs mit Asbest (und Ausnahmen)
Das Umgangsverbot wurde in § 11 neu formuliert und auch der Widerspruch, dass Privatpersonen Asbestprodukte herstellen dürfen, auch wenn diese mehr als 0,1 % Asbest enthalten wurde entdeckt und ausgebessert. Genau dieser Absatz war nämlich für Privatpersonen ausgenommen…
Neben der in der aktuellen Version präziser aufgezählten Verboten und Ausnahmen von den Verboten (ASI Arbeiten, deren Bedeutung und beispielhafte Tätigkeiten) ist vor allem für Privathaushalte der Absatz (7):
Der Wortlaut:
§ 11 Verwendungs- und Tätigkeitsbeschränkungen für Asbest
(7) Die Absätze 1 bis 5 gelten auch für private Haushalte. Führen private Haushalte die nach den Absätzen 1 bis 5 zulässigen Tätigkeiten durch, so sind sie verpflichtet, die Entstehung, Freisetzung und Ausbreitung von Asbestfasern und von potenziell asbestfaserhaltigem Staub so weit wie möglich zu verhindern und im Übrigen zu minimieren.
Es wird explizit festgelegt, dass das Verbot des Umgangs mit Asbest aber auch die Ausnahmen vom Verbot für Privathaushalte gelten. Es wird aber auch gesagt, dass, falls Privathaushalte ASI Arbeiten durchführen, sie die Schutzmaßnahmen nach TRGS 519 treffen müssen.
Die Arbeit an oder mit Asbesthaltigen Produkten, aber ausschließlich die zulässigen Tätigkeiten, sind für Privathaushalte also explizit erlaubt!
Konsequenzen für Privathaushalte
Einfach loslegen? Vorsicht!!!
Zwar entfallen für Privathaushalte einige der Pflichten, die den Auftragnehmern, also Handwerksbetrieben, auferlegt sind wie z.B. Anzeige der Arbeiten an die Behörde, Durchgführung einer Gefährdungsbeurteilung oder erwerb der staatlich anerkannten Fachkunde. Dies gilt aber nur dann,
- wenn dafür gesorgt wird, dass keine oder nur wenige Fasern freigesetzt werden können,
- diese ausschließlich im Gebäude oder auf dem eigenen Grundstück bleiben und
- wenn ausschließlich die Privatpersonen selbst (und ggf. im selben Haushalt lebende Familienangehörige) mit den Asbestprodukten arbeiten.
Sobald Privatpersonen Helfer hinzuholen, Freund oder Bekannte, werden sie Arbeitgeber! Und das bedeutet, es gelten sämtliche Arbeitgeberpflichten nach ArbSchG und GefStoffV und so weiter (z.B. Arbeitsstättenverordnung, etc.)
Außerdem wird im Zweifel unterstellt, dass Privatpersonen ohne Fach- und Sachkunde gar nicht wissen, wie man Faserfreisetzung einschätzt und welche Schutzmaßnahmen erforderlich und auch wirksam sind.
Privatpersonen, die mit Asbest in Eigenregie arbeiten, bewegen sich deshalb auf sehr dünnem rechtlichen Eis.
Wenn Sie sich nicht auskennen, holen Sie Experten hinzu!
LASI LV 45 – Leitlinien zur Gefahrstoffverordnung
 Schließlich noch die LASI: LASI steht eigentlich für Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik. Im hier vorgestellten Fall der von Baden-Württemberg.
Schließlich noch die LASI: LASI steht eigentlich für Länderausschuss für Arbeitsschutz und Sicherheitstechnik. Im hier vorgestellten Fall der von Baden-Württemberg.
Dieser Ausschuss gibt verbindliche Leitlinien heraus, unter anderen die LV45: Leitlinien zur Gefahrstoffverordnung.
Die LV45 bringt noch einmal mehr Licht in den Umgang mit bestimmten Produkten, insbesondere Brandschutzklappen, die Asbest enthälten können. Denn hier stehen sich 2 Rechtsvorschriften im Weg: Brandschutz und Gefahrstoffverordnung.
In Kürze: Im Brandschutz geht es darum, den Schutz vor Bränden dauerhaft zu gewährleisten. Dazu müssen Brandschutzklappen gewartet werden. Um dies zu tun, muss die Klappe aber zum Test fallen – und dabei könnten Asbestfasern freigesetzt werden, was verboten ist. Das ist ein Dilemma.
Leser Sie mehr zum Thema Brandschutzklappen in diesem Beitrag.